Was kann Kunst – Dieser Satz steht über Brittas Blog – und Lion Feuchtwangers in den Zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts entstandener Roman „Erfolg“ gibt darauf eine doppelte Antwort.
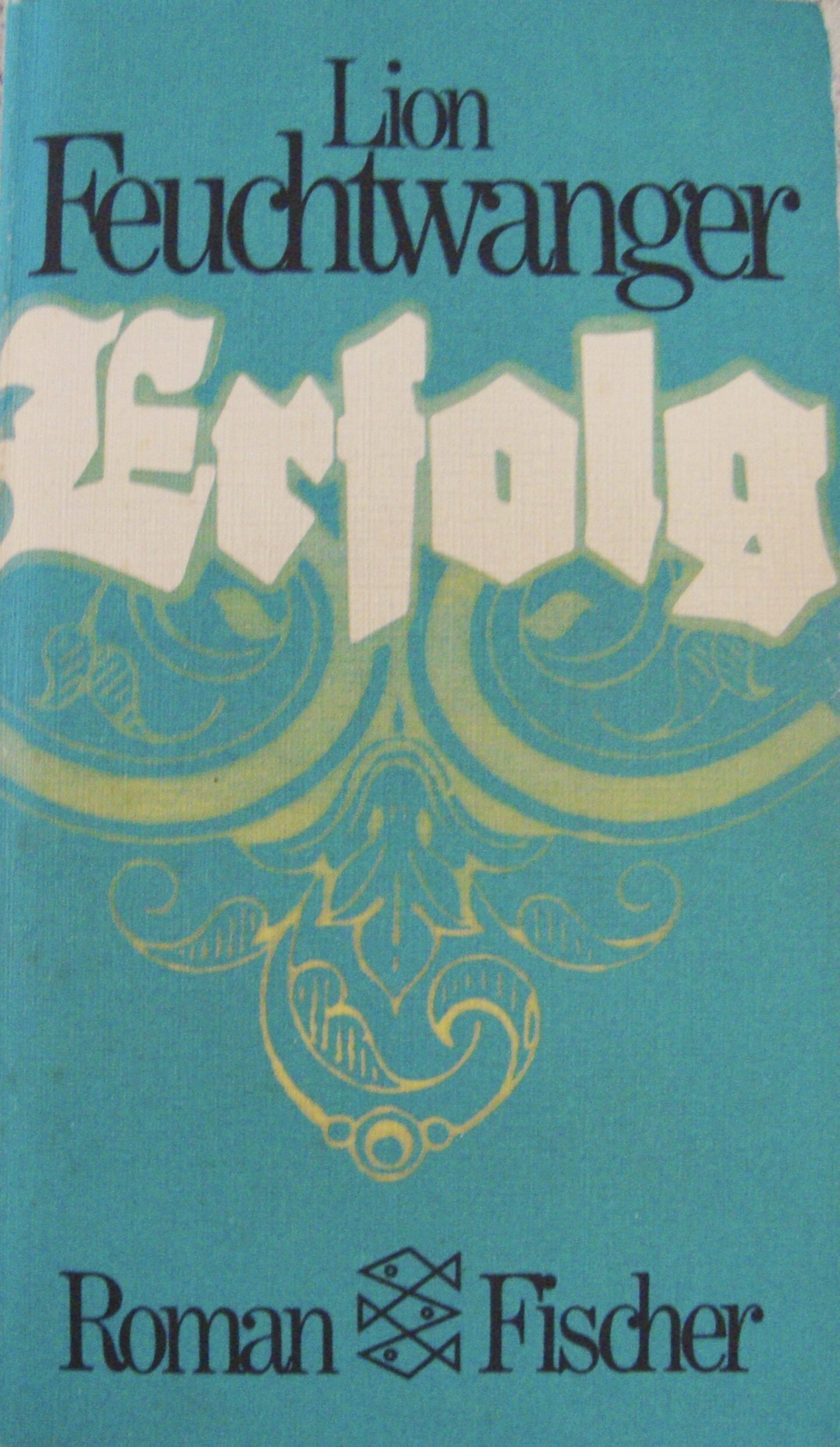
Zum einen erzählt er von einem Justizskandal, ausgelöst durch die provokanten Kunstankäufe eines Münchner Museumsdirektors. Weil man diesem Martin Krüger nicht beikommen kann mit dem Vorwurf, er habe Steuergelder für Sauereien ausgegeben, inszeniert man eine Meineidintrige, die ihn erst ins Gefängnis und schließlich ums Leben bringt. Kunst kann also – wenn auch nur indirekt – tödlich sein.

Um diesen Skandal herum entwirft Feuchtwanger das von Hassliebe geprägte, überaus facettenreiche Panoptikum eines starrsinnigen, stiernackigen, reaktionären Bayern. Eines hundsföttigen Politik- und Justizbetriebs, in dem es immer um Macht und Karriere geht und nie um Gerechtigkeit. Ein Klima, in dem unter dem Label der „Wahrhaft Deutschen“ ein gewisser Kutzner nach der Macht greift, in dem unschwer Adolf Hitler zu erkennen ist (allerdings lässt ihn Feuchtwanger, zwar desillusioniert, aber noch nicht ganz hoffnungslos, am Ende scheitern – 1933, drei Jahre nach Erscheinen des Romans wurde diese Hoffnung Lügen gestraft).

Einer der mächtigsten Fädenzieher in diesem Münchner Betrieb ist der Justizminister Dr. Otto Klenk, ein Machiavellist, der glaubt, die Bewegung Kutzners für seine konservative Politik instrumentalisieren zu können. Der Krüger hingegen passt ihm nicht, er ist ihm schlicht und einfach zu selbstsicher, vertraut zu sehr auf seine Rechte und die Unangreifbarkeit seiner Position. Dabei hat Klenk nicht unbedingt etwas gegen die von Krüger angekauften Kunstwerke. Denn schließlich ist er ein durchaus kunstsinniger und in Maßen für die Moderne aufgeschlossener Mann. Das erweist sich im Roman exemplarisch bei einem Kinobesuch – und mit dieser Passage gibt Feuchtwanger seine eigentliche Antwort auf die Frage, was Kunst kann.
Panzerkreuzer Potemkin

Der Film, den Klenk sich anschaut, heißt „Panzerkreuzer Orlow“ und ist weitgehend deckungsgleich mit Sergej Eisensteins berühmtem Panzerkreuzer Potemkin. Klenk weiß, was ihn im Kino erwartet: ein tendenziöses Machwerk, das er sich eigentlich nur zu Studienzwecken anschaut nach dem Motto „Du musst deinen Feind kennen!“
Was er nicht erwartet, ist, wie sehr ihn der Film gefangen nehmen wird. Wie unter dem Eindruck von Eisensteins hoch emotionalisierten ästhetischen Verfahren sein Widerstand gegen die aufständischen Matrosen dahinschmilzt, wie er mit den solidarischen Bewohnern von Odessa zu sympathisieren beginnt, wie er mit den Meuterern fiebert, dass die zaristischen Truppen nicht das Feuer auf sie eröffnen.
Als der Minister das Kino verlässt, kennt er sich selbst nicht mehr. Er soll einer sein können, der angesichts einer Rebellion sagen würde: Schießt nicht? „In einem Schaufenster sieht er sein Gesicht, sieht darin einen nie gesehenen Zug von Hilflosigkeit. Er schaut ja aus wie ein Tier in der Falle.“
Aber die Verwandlung des mächtigen Ministers dauert nur einen Augenblick. Im nächsten schon ist der Zauber verflogen, die Macht der Kunst bricht sich an der unschönen Wirklichkeit, am Wiedereintritt in die Normalität: „Er lacht, ein bisschen verlegen. Winkt einem Wagen, beklopft seine Pfeife, steckt sie an. Und schon hat er sein Gesicht wieder eingerenkt in das alte, wilde, vergnügte, mit sich einverstandene“.
Was kann Kunst? Lion Feuchtwangers Roman ‘Erfolg’